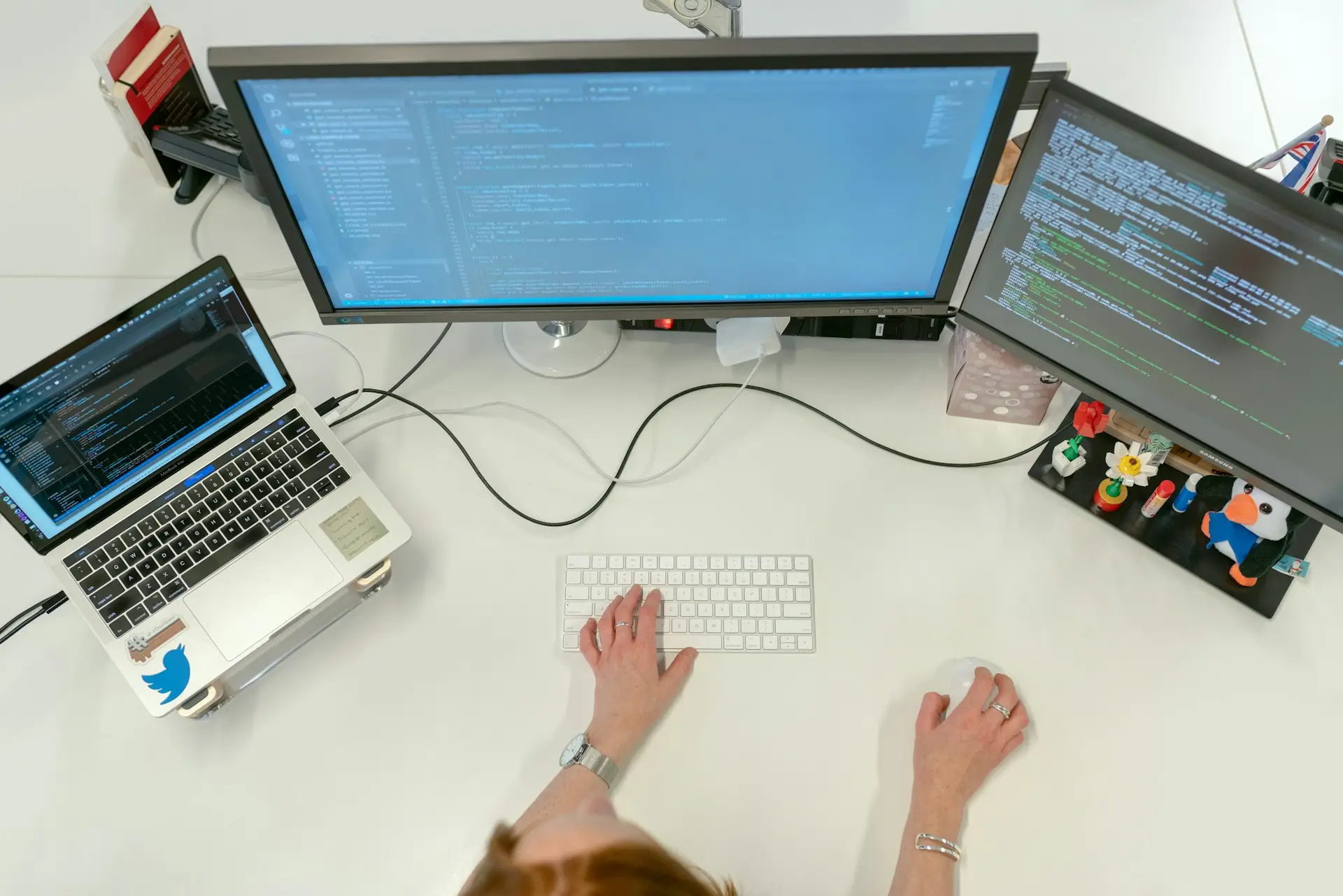Deutschland hat im letzten Jahr einen zentralen Meilenstein in der Energiewende erreicht: Der Anteil erneuerbarer Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung stieg laut Fraunhofer ISE auf 62,7 %. Noch nie war der deutsche Strommix so klimafreundlich. Besonders stark legte die Photovoltaik zu – mit 72,2 Terawattstunden (TWh) wurde ein neuer Höchstwert erzielt, was unter anderem auf günstige Witterungsbedingungen und einen beschleunigten Zubau zurückzuführen ist. Tatsächlich lag der PV-Ausbau sogar über dem selbstgesteckten Ziel der Bundesregierung.
Parallel dazu ging die Stromproduktion aus fossilen Energieträgern deutlich zurück: Der WEC Energy Issues Monitor 2025 gibt an, dass der Anteil von Braunkohle gegenüber dem Vorjahr um 8,4 % sank, Steinkohle verlor sogar 27,6 %. Diese Entwicklung zeigt, dass der Abschied von der Kohle weiter voranschreitet – trotz energiepolitischer Unsicherheiten im Zuge internationaler Krisen.
Ein weiterer Faktor für den hohen Anteil erneuerbarer Energien: Deutschland importierte 2024 deutlich mehr Strom als in den Vorjahren – unterm Strich lag der Importüberschuss laut Fraunhofer bei rund 24,9 TWh. Dies verdeutlicht, wie stark Deutschland inzwischen in den europäischen Strommarkt integriert ist.
Dieser Artikel behandelt den aktuellen Stand der Energiewende in Deutschland – von neuen Rekordwerten bei erneuerbaren Energien über politische Ausbauziele bis hin zum Fachkräftemangel und den Herausforderungen für Unternehmen.
Ausbauziele bis 2035 – und wie realistisch sie sind
Die Bundesregierung plant laut der Internationalen Energieagentur (IEA), den gesamten Stromverbrauch bis 2035 aus erneuerbaren Quellen zu decken. Dafür müssen die derzeitigen Erzeugungsmengen noch einmal stark steigen: Während 2023 etwa 53 % des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt wurden, sollen es bis 2030 schon 80 % sein – das entspricht rund 658 TWh. Das Fernziel für 2035 liegt sogar bei etwa 950 TWh.
Die IEA lobt in ihrem Deutschlandbericht die Fortschritte, kritisiert aber auch die bestehenden Hürden: Bürokratische Verfahren, Netzengpässe und ein Mangel an Planungssicherheit für Unternehmen könnten den Ausbau verzögern. Auch der Hochlauf von grünem Wasserstoff – ein zentraler Baustein für schwer elektrifizierbare Industrieprozesse – stockt. Investitionen bleiben aus, weil Unternehmen unsicher sind, ob sie später auf stabile Lieferketten und wirtschaftlich tragfähige Abnehmer treffen.
Die IEA empfiehlt unter anderem CO₂-Differenzverträge, öffentliche Abnahmegarantien und eine koordinierte Infrastrukturplanung für Strom-, Gas- und Wasserstoffnetze. Wichtig sei außerdem eine klare Kommunikation politischer Ziele und mehr Investitionssicherheit – insbesondere, um auch international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Energiewende als Jobmotor – aber zu wenig Fachkräfte
Trotz schwieriger Konjunkturlage bleibt der Arbeitsmarkt im Bereich der erneuerbaren Energien dynamisch. Laut einer aktuellen Analyse der Bertelsmann Stiftung hat sich die Zahl der Energiewende-Stellenanzeigen seit 2019 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2024 war bereits jede 26. ausgeschriebene Stelle in Deutschland mit dem Thema Energiewende verbunden – besonders stark vertreten in den Bereichen Solarenergie, Windkraft und Energieeffizienz.
Im Solarbereich etwa stieg die Zahl der Beschäftigten laut Bundeswirtschaftsministerium von rund 41.500 im Jahr 2019 auf über 102.000 im Jahr 2024. Auch in der Windenergie gab es ein kräftiges Plus: Die Beschäftigung wuchs hier um 70 % auf rund 53.000 Arbeitsplätze.
Doch das reicht nicht aus. Eine vom BMWK beauftragte Studie des Forschungsinstituts prognos zeigt: Um die politischen Ausbauziele zu erreichen, braucht es bis 2030 zusätzlich rund 550.000 qualifizierte Fachkräfte – allein in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft, Netzausbau und Wasserstoff.
Der größte Bedarf besteht bei Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung und bei Personen mit technischer Weiterbildung – etwa in der Elektrotechnik, im Bauwesen oder in der Anlagenmontage. Aber auch Akademiker mit Bachelorabschluss in Ingenieurwissenschaften oder Umwelttechnik werden zunehmend gesucht. Hinzu kommt: Viele der heute tätigen Fachkräfte erreichen bald das Rentenalter. Der demografische Wandel verschärft den Mangel zusätzlich.
Was Unternehmen jetzt tun müssen
Die Studie zeigt auch, wie Unternehmen gegensteuern. Viele investieren gezielt in Ausbildung und Weiterbildung, um fehlende Fachkräfte intern zu entwickeln. Gleichzeitig gewinnt die internationale Rekrutierung an Bedeutung – insbesondere aus Drittstaaten. Doch hier stehen Firmen häufig vor praktischen Hürden: aufwendige Anerkennungsverfahren, Sprachbarrieren und langwierige Einreiseprozesse erschweren die Integration.
Ein weiterer Hebel: Unternehmen weiten ihre Zielgruppen aus, indem sie Quereinsteiger ansprechen oder gezielt ältere Arbeitnehmer im Erwerbsleben halten. Auch Frauen werden zunehmend für technische Berufe angesprochen – beispielsweise über spezielle Programme und flexible Arbeitszeitmodelle.
Zudem investieren viele Arbeitgeber in ihre Arbeitgebermarke. Themen wie Purpose, Karriereentwicklung, Sicherheit und Benefits gewinnen an Gewicht, wenn es darum geht, sich im Wettbewerb um Talente zu behaupten. Laut BMWK fehlen jedoch nicht nur Fachkräfte auf Baustellen oder im Engineering. Auch in angrenzenden Bereichen wie Projektmanagement, Logistik, IT und Administration gibt es Engpässe – die Transformation betrifft also die gesamte Unternehmensstruktur.

Fazit: Die Technik ist da – der Mensch wird zum Engpass
Die Energiewende in Deutschland ist 2024 technisch auf einem sehr guten Weg. Der Anteil erneuerbarer Energien steigt, fossile Energieträger verlieren an Bedeutung, und die politischen Zielmarken für 2030 und 2035 sind ambitioniert, aber erreichbar. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die dafür nötigen Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden.
Denn ohne Menschen, die Windräder bauen, Solaranlagen planen, Stromnetze erweitern oder Wasserstofflösungen umsetzen, bleibt die Wende unvollendet – und das gilt sowohl für Industrieunternehmen als auch für mittelständische Anbieter in ganz Deutschland.
Wie Amoria Bond unterstützen kann
Um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten, braucht es starke Partner, die Unternehmen und Fachkräfte zielgerichtet zusammenbringen – hier kommt Amoria Bond ins Spiel.
Amoria Bond unterstützt seit Jahren Unternehmen und Bewerber in der Energiebranche – von der Standortsuche bis zur Schlüsselbesetzung.
Sie suchen qualifizierte Expertinnen für Ihre Projekte im Bereich Windkraft, Photovoltaik oder Energiespeicher? Oder Sie sind Fachkraft in der Energiewirtschaft und möchten den nächsten Karriereschritt gehen?
Kontaktieren Sie uns für individuelle Beratung und erfolgreiche Vermittlung!